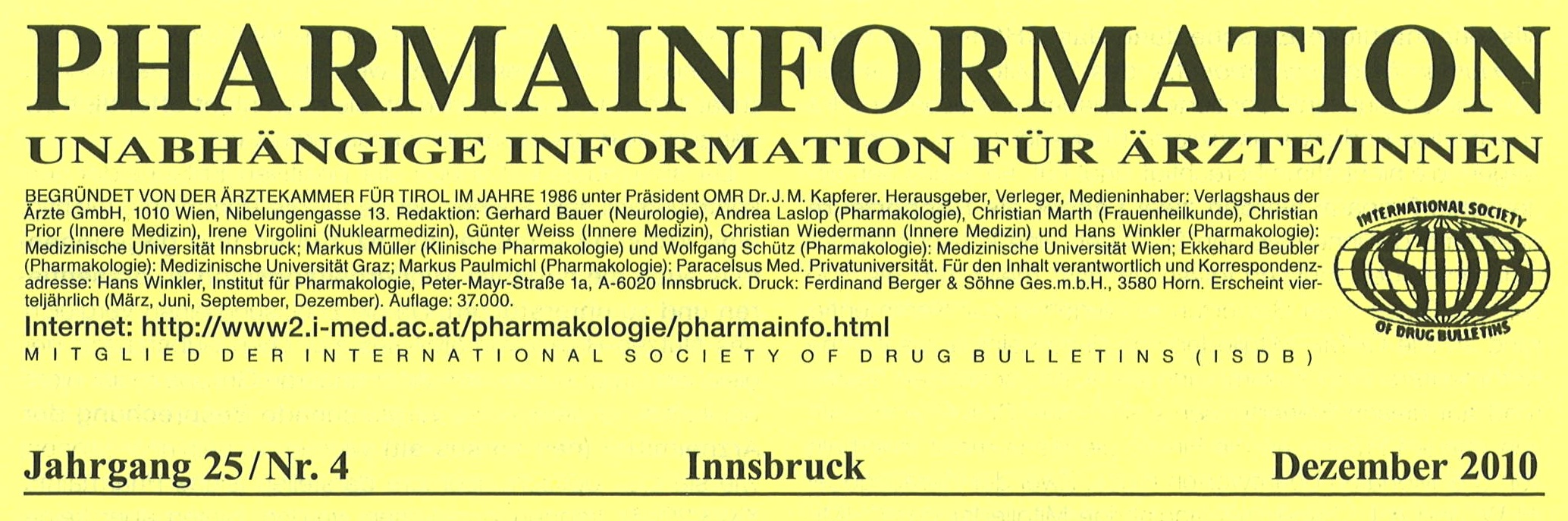
Inhalt
- Editorial
- Osteoporose:
- Opiatobstipation:
- Rosiglitazon (Avandia): Marktsuspendierung
Editorial: 25 Jahre Pharmainformation, 15 Jahre EMA in London
Wir wollen diese beiden Jubiläen zusammen diskutieren, allerdings nicht um eine vergleichbare Wichtigkeit zu insinuieren, sondern um aufzuzeigen, dass die zentrale Arzneimittelzulassung im Rahmen der EMA (European Medicine Agency, früher EMEA) für die Aufgabe einer kritischen und unabhängigen Publikation, wie sie die Pharmainformation darstellt, von Bedeutung ist.
Vor 5 Jahren, zum 20-Jahr-Jubiläum, haben wir einige grundsätzliche Fragen zum Arzneimittelmarkt einschließlich der Rolle der pharmazeutischen Industrie diskutiert (Pharmainfo XX/3/2005). Diese Info ist, wie auch alle anderen Jahrgänge der Pharmainfo, im Internet abrufbar (in Google Pharmainformation eingeben, dann erscheint diese Info als erster Eintrag mit allen Nummern und einer Sachwörtersuchmöglichkeit). Nach wie vor wird die Pharmainfo von ehrenamtlichen Vertretern der 4 österreichischen Medizinischen Universitäten für die Österreichische Ärztekammer in voller redaktioneller Unabhängigkeit herausgegeben. Auch das Ziel der Info nicht gegen Medikamente, sondern für das gute Medikament zu sein und andererseits Medikamente mit fraglichem oder negativem Risiko/Nutzenverhältnis offen zu kritisieren, hat sich nicht geändert.
In den letzten 5 Jahren ist die pharmazeutische Industrie noch mehr unter den Druck der Aktionäre gekommen, die einträgliche Rendite einfordern. Dass dieser Druck zu negativen Phänomenen führen kann, haben wir damals diskutiert. Inzwischen haben sich Gegenmaßnahmen konsolidiert, die vor allem von führenden wissenschaftlichen Zeitschriften, z.B. New England Journal of Medicine oder Lancet initiiert wurden. Die Registrierung von Studien (vor Studienbeginn) über Arzneimittel ist etabliert, eine Möglichkeit der Einsichtnahme auch in negative Resultate ist im Kommen, eine Inspektion von Studien durch die Zulassungsbehörden auf ihre ethische, methodische und wissenschaftliche Korrektheit wird immer häufiger durchgeführt. Autoren/innen von wissenschaftlichen Publikationen müssen finanzielle Zuwendungen von Seiten der Industrie bereits in vielen Zeitschriften, zumindest in denen, die einen Anspruch auf Seriosität erheben, darlegen. Die Herausgeber der wichtigsten medizinischen Zeitschriften haben sich nun auf ein einheitliches Schema zur Deklarierung von Interessenskonflikten (Uniform conflict disclosures) geeinigt (NEJM 363,188,2010). Zusätzlich wurde begonnen (vor allem in den USA im Rahmen des neuen Gesetzes zur Gesundheitsreform: ab 2013), die pharmazeutische Industrie zu verpflichten, alle Geldflüsse an Wissenschafter, Kliniker und Ärzte/Ärztinnen offenzulegen.
Die letzten 5 Jahre haben den Eindruck bestätigt, dass es schwieriger wird in vielen Indikationsbereichen neue, innovative Substanzen zu finden. Insbesondere bei Erkrankungen mit besonders hoher Prävalenz (z.B. Hypertension, Magenbeschwerden) dürften kaum mehr bessere Medikamente nachkommen, gleichzeitig werden die „Blockbusters“ bereits durch Generika ersetzt. Daher wird nun versucht, vor allem auf dem Gebiet der Krebstherapie (wo der „medical need“ besonders stark ist) zu reüssieren. Der relative Anteil von Krebstherapeutika ist in der Zulassung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dies hat einerseits zu wesentlichen Durchbrüchen geführt, andererseits werden auch Substanzen propagiert, die einen marginalen Benefit bieten, wie z.B. ein „progression free survival“ von 4 Wochen, ohne dass es zu einer Verlängerung des „overall survival“ kommt. Die Frage nach der klinischen Relevanz, aber noch mehr nach dem Nutzen für die Patienten/innen, die ja auch die Nebenwirkungen zu erleiden haben, ist berechtigt. Gleichzeitig werden für diese Mittel Höchstpreise verlangt, die offensichtlich davon getrieben sind, dass es mit einer doch limitierten Zahl von Patienten/innen z.B. verglichen mit einer Hochdruck- oder Diabetestherapie, schwierig ist, die vom Aktienmarkt geforderte Gewinnerhaltung, bzw. auch Steigerung zu erzielen. Die wissenschaftliche aber auch politische Diskussion hat begonnen, ob der Preis eines Medikaments nicht nur nach der Gewinnoptimierung festzusetzen sei, sondern auch den Wert des Nutzens für den/die Patienten/in einzubeziehen habe.
In den letzten Jahrzehnten hat die Qualität der Neuzulassungen insbesondere betreffend die Nutzen/Risiko Abwägung deutlich zugenommen, und zwar einerseits durch den Fortschritt der Wissenschaft und der verbesserten Testung von Arzneimitteln, andererseits durch den Wechsel von nationalen Zulassungen über das dezentrale europäische Verfahren zur zentralen europäischen Zulassung bei der EMA in London.
Vor 15 Jahren hat dieses zentrale Verfahren begonnen, verpflichtend war es zuerst nur für biotechnologisch hergestellte Medikamente. Inzwischen sind zahlreiche weitere Indikationen nur mehr über eine zentrale Zulassung zu bekommen, und de facto werden heutzutage fast alle neuartigen Wirkstoffe über die EMA London eingereicht. Man kann zwar noch das dezentrale Verfahren (das Verfahren der gegenseitigen Anerkennung) für einige Indikationen benutzen, d.h. zuerst eine Zulassung in einem Land zu erreichen, und dann die anderen Länder in die Zulassung miteinzubeziehen. Aber auch bei diesem Verfahren geht die letzte Entscheidung nach London, wenn es zu widersprüchlichen Ansichten zwischen den Ländern kommt. In London trifft die wissenschaftliche Entscheidung das CHMP (Committee for Human Medicinal Products), das 27 Mitglieder aus den EU-Staaten plus 5 kooptierte Mitglieder mit besonderer Fachexpertise und 2 assoziierte Mitglieder (Island und Norwegen, die nicht stimmberechtigt sind) hat. Für jedes neu eingereichte Präparat werden 2 Länder als Rapporteure bestimmt, die innerhalb von 80 Tagen eine kritische Bewertung schreiben müssen (diese umfasst meist 100 bis 300 Seiten). Diese zwei Bewertungen ergehen zur Kommentierung an alle CHMP-Mitglieder, von denen einige zusätzliche Kommentare (von Zustimmung bis Kritik) schreiben. Basierend auf diesen Bewertungen erstellt das CHMP eine Liste von offenen Fragen an die Firma, die diese meist innerhalb von 3 Monaten beantworten muss. Zwei der Herausgeber (H.W. und A.L.) haben als langjährige Mitglieder des CHMP diese Verfahren direkt mitgemacht und können aus persönlicher Erfahrung feststellen, dass gerade das Prinzip der zwei unabhängigen Rapporteursberichte eine wesentliche Garantie dafür abgibt, dass die vorliegenden Daten sehr kompetent und kritisch durchleuchtet werden. Welches Land steht schon gerne in der Diskussion im CHMP als wenig kompetent oder unkritisch da, weil es z.B. einen wesentlichen Punkt übersehen hat? Nachdem die Firma die Fragen beantwortet hat, zeichnet sich langsam ab - und zwar wiederum über die Bewertung durch die 2 Rapporteure, durch zusätzliche Kommentare aller Länder und durch oft stundenlange Diskussionen im Plenum des CHMP - in welche Richtung die Bewertung geht. Ist eine negative Bewertung absehbar (erfolgt in ca. 10-20% der Ansuchen), hat die Firma noch das Recht einer oral presentation (30 min) und einer nachfolgenden Diskussion im CHMP. Dann erfolgt die Meinungsbildung entweder durch consensus (positiv oder negativ) bzw. durch Abstimmung, wobei 17 Stimmen für eine positive Entscheidung notwendig sind. Abstimmungsergebnisse von 16 zu 16 oder 17 zu 15 sind nicht so selten und zeigen auf, dass man auch im wissenschaftlichen Bereich geteilter Meinung sein kann. Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Entscheidung werden im EPAR (European Public Assessment Report - auf der Homepage der EMA abrufbar, siehe Pharmainfo XXV/1/2010) veröffentlicht, auch das Abstimmungsresultat, und die Argumente etwaiger Gegenstimmen werden inzwischen angeführt.
Die Tatsache, dass es knappe Abstimmungsentscheidungen gibt zeigt ungelöste Probleme in der Bewertung auf. Zwei Punkte, um dem Abhilfe zu schaffen, seien erwähnt. Studienergebnisse können beeindruckend präsentiert werden, dies beweist aber nicht die Korrektheit aller Vorgänge. Es wird daher in den letzten Jahren das Instrument der Inspektionder Studiendurchführung vor Ort vermehrt angewandt. Dies hat dazu geführt, dass in einzelnen Fällen die Verlässlichkeit der Studiendaten angezweifelt werden musste und eine Zulassung verweigert wurde.
Der Pharmakovigilanz, insbesondere dann, wenn in den Studien Signale für Nebenwirkungsprobleme aufgetreten sind, wird heute z.B. durch Verpflichtung zu Studien und genauen Meldungen nach der Zulassung vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt (Risk Management Plan).
Zusammengefasst hat die EMA in den letzten 15 Jahren einen wesentlichen Erfolg zur Qualitätsverbesserung der Zulassung erzielt. Ein Präparat erhält nur eine zentrale Zulassung nachdem das Nutzen/Risiko Verhältnis seriös bewertet wurde. Natürlich verbleiben viele Möglichkeiten der Verbesserung, z.B. was die Transparenz der Verfahren betrifft. Weiters fehlen derzeit gesetzliche Grundlagen, bei einer neuen Substanz vergleichende Studien mit den bereits zugelassenen Medikamenten zu verlangen. Die Belegung des Langzeitnutzens, bzw. des Risikos (über 1 Jahr hinaus) ist derzeit bei der Zulassung im Regelfall keine Bedingung. Trotzdem bedeutet eine zentrale Zulassung für eine kritische Publikation wie die Pharmainformation, dass man die Seriosität des Verfahrens, welches auch auf zahlreichen zusätzlichen Unterlagen beruht, die noch nicht öffentlich zugänglich sind, grundsätzlich akzeptieren kann.
Da aber auch in London die positiven Entscheidungen kontroversiell sein können, ist es für die Pharmainfo wichtig, eine kritische Analyse durchzuführen und gegebenenfalls auch die negative Minderheitsposition zu präsentieren und zu unterstützen. Da die Zulassung einen Vergleich des Nutzen/Risikoverhältnisses zwischen Substanzen der gleichen Gruppe oder von einer anderen Gruppe meist nicht beinhaltet, ist gerade die vergleichende Besprechung der Arzneimittel (neu versus alt) wichtig. Scheininnovationen wie sie z.B. optische Isomere darstellen (siehe Pharmainfo XX/3/2005) können zugelassen werden, bieten aber keine Vorteile und sind wegen meist höherer Preise nicht zweckmäßig. Neu zugelassene Medikamente haben z.T. ein noch unbekanntes Risikopotential und sind daher gegenüber bewährten Präparaten nur mit Zurückhaltung einzusetzen. Dies sind nur einige Punkte, die zeigen sollen, dass auch heute eine kritische Bewertung wichtig ist, die letztlich dem Hauptzweck der Pharmainfo dienen soll, nämlich dem Arzt/der Ärztin unabhängige und kritische Argumente zu liefern um seine/ihre Entscheidung, welche Mittel er/sie letztlich verschreibt, zu untermauern.
Zwei neue Substanzen in der Therapie der Osteoporose
Die primäre Osteoporose ist eine häufige Alterserkrankung, die über Abbau der Knochensubstanz zu Frakturen führt. Etwa 30% aller postmenopausalen Frauen entwickeln eine klinisch relevante Osteoporose. Da die Frakturen mit Schmerzen und Immobilisation assoziiert sind, stellt die Osteoporose ein großes gesundheitliches und volkswirtschaftliches Problem dar. Die wirksame Behandlung der Osteoporose kann bei älteren, gebrechlichen Patientinnen, wie in einer Metaanalyse gezeigt wurde, die Lebenszeit verlängern (1). Über die Möglichkeiten der Therapie und auch Prävention der Osteoporose wurde im Rahmen der „Pharmainformation“ bereits mehrfach berichtet (siehe Pharmainfo XXII/1/2007).
Kürzlich erhielten zwei neue Substanzen eine europäische Zulassung (EMA):
1. Lasofoxifen (Fablyn)
gehört zur Gruppe der selektiven Östrogenrezeptormodulatoren (SERM) und wirkt damit am Östrogenrezeptor zum Teil als Agonist (was im Knochen erwünscht ist), zum Teil aber auch als Antagonist (was am Endometrium und der Brustdrüse erwünscht ist). Östrogene verbessern zwar (siehe Pharmainfo XV/3/2000, XVI/2/2001) als reine Agonisten die Knochendichte, erhöhen jedoch das Risiko eines Endometrium- und Mammakarzinomrisikos. Lasofoxifen hat in einer großen prospektiv randomisierten Studie (PEARL-Studie: 1a) mit knapp 9.000 postmenopausalen Patientinnen nach 5 Jahren gegenüber Placebo zu einer deutlichen Reduktion von Wirbelsäulenfrakturen (13,1 vs 22,4 Ereignisse pro 1.000 Personen/Jahr) und zu einer geringeren Reduktion von nicht vertebralen Knochenbrüchen (18,7 vs 24,5 Ereignisse pro 1.000 Personen/Jahr) geführt. Wie andere SERMs (z.B. Raloxifen: Evista) oder klassische Antiöstrogene, wie Tamoxifen (Ebefen, Nolvadex, Tamoxifen Generika), hat Lasofoxifen die Rate an hormonrezeptor-positiven Mammakarzinomendeutlich reduziert (0,3 vs 1,7 Ereignisse pro 1.000 Personen/Jahr). Auch bezüglich anderer klinischer Eckpunkte wie akute koronare Herzerkrankungen sowie Schlaganfällen konnte eine Reduktion in der Lasofoxifen-Gruppe (von 0,75% auf 0,51%, bzw. von 0,39% auf 0,25%) beobachtet werden. Die häufigsten Nebenwirkungen von Lasofoxifen sind Muskelkrämpfe, klimakterische Beschwerden, insbesondere Hitzewallungen, vaginale Pilzinfektionen, uterine Polypen, Endometrium-Hypertrophien, Arthralgien und Zunahme von venösen Thromboembolien (von 0,14% auf 0,29%). Eine Zunahme an Endometriumkarzinomen konnte nicht beobachtet werden (1a).
Derzeit ist als zweiter SERM Raloxifen (Evista) in derselben Indikation zugelassen. Zum Vergleich dieser Substanz mit Lasofoxifen kann man folgendes feststellen (siehe auch 2): Beide Substanzen haben ähnliche Wirkungen auf die Knochendichte. Zwar war Lasofoxifen in der PEARL-Studie imstande, 42% der radiologisch gesicherten Wirbelsäulenbrüche zu verhindern, allerdings war dieser Effekt für klinisch symptomatische Frakturen nicht signifikant. Im Gegensatz dazu zeigte Raloxifen im MORE-Trial (3) eine signifikante Reduktion sowohl von radiographischen Wirbelkörperbrüchen als auch neuen klinisch symptomatischen Frakturen. In der PEARL-Studie zeigte Lasofoxifen, allerdings erst nach 5 Jahren eine Reduktion an nicht-vertebralen Frakturen (vor allem Unterarm), während für Raloxifen hier kein Effekt zu sehen war (3). Beide SERMs sind nicht imstande, die Frequenz von Oberschenkelhalsfrakturen zu reduzieren.
Für kardiovaskuläre Ereignisse und Schlaganfälle zeigte Lasofoxifen (siehe oben) eine Reduktion, für Raloxifen ergaben sich im MORE Trial für Frauen mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko ebenfalls eine Reduktion (4), das wurde allerdings von weiteren Studien nicht bestätigt, die Zahl der tödlichen Schlaganfälle stieg sogar bei Frauen mit hohem Ausgangsrisiko an (5).
Bezüglich der Nebenwirkungen sind beide Substanzen vergleichbar, venöse Thromboembolien nehmen bei beiden Substanzen um das zwei- bis vierfache zu. Der Vergleich von Lasofoxifen mit Raloxifen ergibt somit wenig Unterschiede und insgesamt keine besonderen Vorteile für das neue Produkt. Nur eine direkte Vergleichsstudie könnte belegen, ob eine der beiden Substanzen ein besseres Risiko/Nutzenverhältnis hat. Eine zweifellos relevante Wirkung, die den Einsatz der SERMs in der Therapie der Osteoporose interessant macht, ist die etwa 85%-ige Risikosenkung für hormonrezeptor-positive Mammakarzinome.
Zusammenfassend stellt Lasofoxifen einen neuen SERM dar, der gegenüber dem etablierten Raloxifen vergleichbare Wirkungen und Nebenwirkungen zeigt.
2. Denosumab (Prolia)
Ein zentraler Faktor für die Regulation der Knochenbiologie ist der von den Osteoblasten gebildete Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANKL), der als der wichtigste Signalüberträger von Osteoblasten zu Osteoklasten gilt (6). RANKL bindet an einem auf der Oberfläche von Präosteoklasten lokalisierten Rezeptor (RANK) und führt zu einer Aktivierung und Lebensverlängerung der Osteoklasten. Der humane monoklonale Antikörper Denosumab (Prolia) verhindert durch Bindung an RANKL die Aktivierung der Osteoklasten und als Folge die Osteoporose. Damit wird erstmals ein zentrales Molekül in der Entstehung der Osteoporose genützt. Die Marktzulassung von Denosumab stützt sich auf die Ergebnisse von sechs Phase III-Studien, die zeigen, dass Denosumab die Knochendichte im gesamten Skelett erhöht. In zwei zulassungsrelevanten Studien bei postmenopausalen Frauen mit Osteoporose bzw. bei Männern mit Prostatakarzinom und Knochendichteverlust unter Androgendeprivationstherapie sind außerdem neue Frakturen als Endpunkte festgelegt worden. Im FREEDOM Trial (7) wurden knapp 8.000 postmenopausale Frauen mit bekannter Osteoporose in eine Placebogruppe sowie Denosumab (s.c. Injektion alle 6 Monate) randomisiert. Wirbelkörperfrakturen traten binnen 36 Monaten bei 2,3% im Behandlungsarm und 7,2% in der Placebogruppe auf (relative Risikoreduktion 68%), Oberschenkelhalsbrüche traten bei 1,2% in der Placebogruppe und 0,7% im Verum-Arm auf (relative Risikoreduktion 40%) (2). Für die Autoren dieser Studie (7) sind die Resultate mit Denosumab für vertebrale Frakturen besser als mit oralen Bisphosphonaten, aber vergleichbar zur jährlichen i.v. Gabe von Zoledronsäure (Zometa, Aclasta), für nicht vertrebrale Frakturen sind sie auch mit oralen Bisphosphonaten vergleichbar.
In der HALT-Studie (Hormone ablation bone loss trial) wurden 1.468 Männer, die aufgrund eines nicht-metastasierten Prostatakarzinoms eine Androgendeprivationstherapie erhielten, inkludiert (3). Nach 36 Monaten wurde an Patienten, die mit Denosumab anstatt Placebo behandelt wurden, ein um 62% verringertes Risiko für neue Wirbelkörperfrakturenfestgestellt, wobei die Risikoreduktion (1,5% Wirbelkörperfrakturen bei Denosumab und 3,9% in der Placebogruppe) bereits nach 12 Monaten signifikant war. Das Risiko einer Knochenfraktur konnte somit in beiden Studien in der gleichen Größenordnung gesenkt werden.
Denosumab war gut verträglich, im Freedom Trial waren in der Verumgruppe Flatulenz, Ekzeme, Hautinfektionen (einschließlich Erysipel) signifikant und Infektionen der Harn- und oberen Luftwege etwas häufiger, in der HALT-Studie Katarakte. Seltene Fälle von Kiefernekrosen, wie sie auch für Biphosphonate beschrieben sind, wurden bereits vor Zulassung beobachtet (siehe Fachinformation).
Die geringe Nebenwirkungsrate, kombiniert mit einer hohen Effektivität, macht Denosumab zweifellos zu einer interessanten Behandlungsmöglichkeit für Osteoporose oder therapieinduzierten Knochenverlust. Eine nur zweimalige Gabe pro Jahr hat den wichtigen Vorteil einer guten Compliance. Grundsätzliche Bedenken betreffend den Langzeiteinsatz von Denosumab beziehen sich auf die Möglichkeit der Beeinflussung von immunologischen Prozessen, nachdem RANKL nicht nur im Knochen sondern auch von immunkompetenten Zellen exprimiert wird. Bisher konnte in keiner der publizierten Studien eine signifikante Zunahme von malignen Erkrankungen oder schweren Infekten beobachtet werden. Auch die Häufigkeit von Kiefernekrosen ist derzeit nicht abschätzbar. Diese Sicherheitsaspekte stehen jedoch nach Markteinführung unter besonderer Beobachtung durch die EMA in London. Nach 2 - 3 Jahren wird absehbar sein, welchen Platz dieses Präparat in der Osteoporose Therapie finden wird.
Literatur:
(1) J Clin Endocrinol Metab 95,1174,2010
(1a) NEJM 362, 686, 2010
(2) NEJM 362,752,2010
(3) JAMA 282,637,1999
(4) JAMA 287,847,2002
(5) NEJM 355,125,2006
(6) Adv Exp Med Biol 658,77,2010
(7) NEJM 361, 756, 2009
(8) NEJM 361, 745, 2009
Opiatobstipation
Eine häufige Nebenwirkung der Opiattherapie ist eine Obstipation, die durch Opioidrezeptoren im Darm ausgelöst wird. In der letzten Zeit wurden zwei Präparate zugelassen, die diese Nebenwirkung reduzieren sollen.
Methylnaltrexon (Relistor)
Relistor erhielt eine europäische Zulassung für die Indikation: Zur Behandlung von opioidinduzierter Obstipation bei Patienten/innen in fortgeschrittenem Krankheitsstadium, die eine palliative Behandlung erhalten, wenn das Ansprechen auf eine Therapie mit den üblichen Laxantien unzureichend ist.
Der Opiatantagonist Methylnaltrexon kann als quarternäre und daher schlecht Membran-gängige Verbindung die Blut-Hirnschranke nicht durchdringen und entfaltet daher seine antagonistische Wirkung auf µ-Opioid-Rezeptoren nur in der Peripherie. Im Darm bewirken die µ-Opioid-Rezeptoren eine Hemmung der Freisetzung von Acetylcholin, was zu einer Erschlaffung der Darmmuskulatur führt. Durch die Hemmung der Motorik und des Transportes des Darminhalts kommt es unter Wasserentzug zur Stuhleindickung und Obstipation. Diese bei Opioidtherapie häufige Nebenwirkung ist durch Laxantien beeinflussbar, Opiatantagonisten können sie spezifisch aufheben. Von Methylnaltrexon war zu erwarten, dass dies erfolgt, ohne dass die zentrale analgetische Wirkung der Opiate aufgehoben wird.
Zwei Zulassungsstudien (siehe 1) haben dieses Konzept bestätigt. In einer Studie (2) erhielten 133 Patienten/innen, bei denen konventionelle Laxantien die Obstipation im Rahmen einer palliativen Opiattherapie bei Krebserkrankung nicht ausreichend verbesserten, entweder s.c. Methylnaltrexon oder Placebo jeden 2. Tag für 2 Wochen. Im Verlauf der 13 Tage kam es innerhalb von 4 Stunden nach der jeweiligen Injektion in der Placebogruppe bei 7 bis 15% der Patienten/innen zum Stuhlgang, in der Methylnaltrexongruppe war dies bei 38 bis 48% der Fall, für 24 Stunden waren die entsprechenden Werte 27% und 68% - ein gegenüber Placebo deutlich verbessertes Ansprechen. Allerdings tritt bei einem beträchtlichen Teil der Patienten/innen keine Wirkung ein, was die Autoren dieser Studie darauf zurückführen, dass bei diesen die Obstipation nicht durch µ-Opioid-Rezeptoren verursacht wird und andere Maßnahmen versucht werden müssen. Der analgetische Effekt der Opiate wurde nicht beeinflusst. Methylnaltrexon war gut verträglich mit flüchtigen Bauchkrämpfen und Flatulenz als die häufigsten Nebenwirkungen. Nach Markteinführung wurden Fälle von gastrointestinaler Perforation nach Relistorgabe berichtet und entsprechende Warnhinweise in die Fachinformation aufgenommen.
Zusammengefasst: Methylnaltrexon ermöglicht bei s.c. Injektion bei Opioid-induzierter Obstipation innerhalb von 4 Stunden bei ca. 50% der Patienten/innen und innerhalb von 24 Stunden bei 68% einen Stuhlgang (Placebo nur bis 15% bzw. 26,9%). Es erscheint gut verträglich, bei einigen Patienten/innen kommt es zu Flatulenz und Bauchkrämpfen. Es muss s.c. verabreicht werden.
Die kausale Therapie der Opiatobstipation durch Methylnaltrexon stellt einen Fortschritt dar, ist allerdings nicht bei allen Patienten/innen erfolgreich. Das Auftreten von kürzlich berichteten Darmperforationen stellt aber ein noch nicht abschließend zu bewertendes Risiko dar.
Literatur:
(1) EPAR, Homepage EMA
(2) NEJM 358,2332,2008
Oxycodon/Naloxon Kombination (Targin)
Naloxon (ein Opioidantagonist) unterliegt bei oraler Zufuhr einem sehr hohen first pass Effekt, sodass nur ca. 2% den systemischen Kreislauf erreichen. Mit der Zugabe von Naloxon zu dem Opioid Oxycodon sollen die peripheren Opioid-Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt blockiert werden, ohne dass die zentrale analgetische Wirkung des Opioids aufgehoben wird.
In 4 publizierten Studien wurde die klinische Wirkung des Kombinationspräparates untersucht (1-4). Nahezu alle Patienten/innen litten an nicht-Malignom Schmerzen, die Oxycodon Dosen reichten von 20 – 80 mg (mit 10 – 40 mg Naloxon). In allen Studien konnte gezeigt werden, dass Naloxon-Zugabe die analgetische Wirkung von Oxycodon nicht signifikant veränderte (1-4).
Für die Darmfunktion wurden in 3 Arbeiten (1,3,4) statistisch signifikante Resultate erhalten. Die Zugabe von Naloxon verbesserte den Bowel Function Index (BFI: eine Bewertung für Leichtigkeit der Defäkation, Gefühl der kompletten Darmentleerung und Selbsteinschätzung hinsichtlich der Obstipation), die Anzahl der kompletten, spontanen Darmentleerungen und die Stuhlkonsistenz. Ob die gleichen oder bessere Resultate aber mit Laxantien erreichbar waren, bleibt unklar. In einer Studie (1) wurden Laxantien vor der Doppelblindphase gestoppt, bei Bedarf allerdings erlaubt, in den zwei anderen (3,4) eine fixe Dosis ermöglicht. Der Verbrauch von Laxantien war dann in der Naloxongruppe niedriger (43% versus 63,7% der Patienten/innen). Allerdings konnte ohne Laxantiengabe keine optimale Darmfunktion (siehe z.B. 1) erreicht werden. Die Frage bleibt daher ungeklärt, ob nicht eine individualisierte Laxantienoptimierung die besten Resultate erreicht hätte.
Für das Kombinationspräparat gilt eine Tagesmaximaldosis von 40 mg Oxycodon/20 mg Naloxon. Diese dürfte bei starken Nichtkarzinomschmerzen ausreichen, aber nicht für Karzinompatienten/innen, die auch in den oben zitierten Studien kaum vertreten waren. Die Oxycodon-Tagesmaximaldosis beträgt für diese Patienten/innen 400 mg. Dies würde eine Gabe von 200 mg Naloxon bedingen. Bei höheren Dosen von Naloxon über die zugelassene Menge von 20 mg hinaus, wird diese Substanz nicht mehr ausreichend im first pass Effekt abgebaut und erreicht daher den systemischen Kreislauf mit der Folge der Reduktion der Wirkung von Oxycodon.
Zusammenfassung: Die Kombination von Oxycodon mit Naloxon führt, wenn die Tagesdosis von 40 mg Oxycodon und 20 mg Naloxon nicht überschritten wird, zu keiner Reduktion der Analgesie. Die obstipierende Wirkung des Opiats wird durch Naloxon reduziert, allerdings wurde nicht gezeigt, ob nicht Laxantien eine gleich gute oder sogar bessere Wirkung haben. Das Kombinationspräparat ist für Karzinompatienten/innen, da die Dosis nicht gesteigert werden kann, nicht geeignet.
Eine freie Auswahl des optimalen Opioids mit einer individuell angezeigten Laxantientherapie dürfte die bessere therapeutische Alternative darstellen. Für schwere Fälle von Obstipation, insbesondere bei Karzinompatienten/innen bietet Methylnaltrexon (siehe oben) eine Therapiemöglichkeit.
Literatur:
(1) Eur J Pain 13,56,2009
(2) J Pain 9,1144,2008
(3) Curr Med Res Opin 24,3503,2008
(4) Exp Opin Pharmacother 10,531,2009
Marktzulassung von Rosiglitazon (Avandia) suspendiert
Wir haben die Glitazone (Pioglitazon: Actos und Rosiglitazon: Avandia) als Diabetesmittel fernerer Wahl (Pharmainfo XIV/4/1999; XXII/4/2007; XXIII/4/2008) bezeichnet, da sie durch Nebenwirkungen wie Herzinsuffizienz und Knochenbrüchen (bei Frauen eine zusätzliche Fraktur pro 100 Frauen pro Jahr) belastet sind. Für Rosiglitazon war seit längerem ein zusätzliches Risiko für Myokardinfarkte in Diskussion (Pharmainfo XXII/4/2007). Die Ärzte/innen haben international bereits durch sinkende Verschreibungszahlen darauf reagiert. Jetzt hat auch die EMA in London (Sept. 2010) die Suspension der Marktzulassung beantragt und damit den zwei Mitgliedsländern des CHMP, die vor 10 Jahren gegen die Zulassung stimmten (siehe BMJ 530,341,2010), nachträglich Recht gegeben.
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 22. November 2010
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



